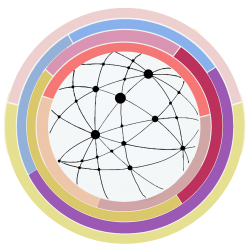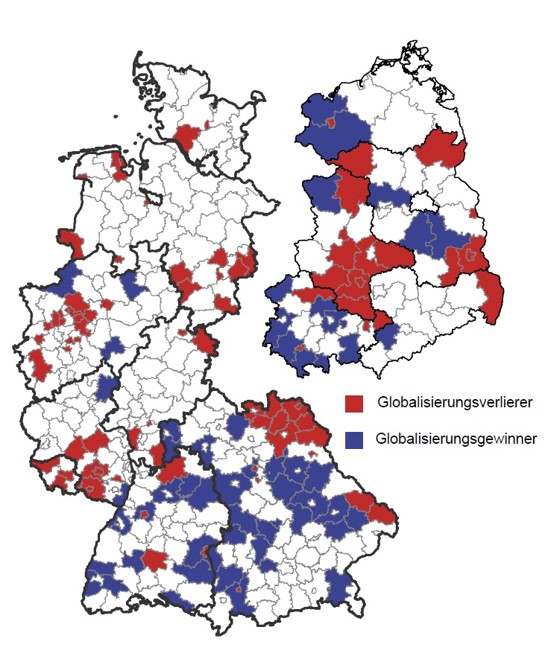Von Nora Kolhoff
Vor internationalen Schiedsgerichten können Firmen Staaten verklagen und so ihre Investitionen im Ausland sichern – ein Verfahren, das tausende Kritiker auf die Straßen trieb. Ist das System noch reformierbar?
Spricht man über Schiedsgerichte, fällt in Deutschland fast immer ein Name: Vattenfall. Ein schwedisches Unternehmen verklagt die Bundesregierung, und zwar vor einem Schiedsgericht in Washington. Vattenfall fordert fast fünf Milliarden Euro – wegen des Gesetzes, das den deutschen Atom-Ausstieg besiegelt hat. Dieser bedeutete einen großen Sieg für erbitterte Atomkraftgegner, aber einen herben Verlust für Vattenfall. Milliardeninvestitionen in Kraftwerke wurden wertlos.
Regelmäßig verklagen Investoren Staaten auf Schadensersatz. Schiedsgerichte haben sich rund um den Globus etabliert. Möglich machen das sogenannte Investitionsschutzabkommen. Haben zwei Staaten ein solches abgeschlossen, können Investoren aus dem einen Staat das andere Land, in dem sie investiert haben, verklagen. Das soll sie vor Enteignung schützen. In der Regel entscheiden drei Richter über die oft milliardenschweren Fälle. Beide Streitparteien entsenden dafür eine Person und bestimmen gemeinsam eine dritte.
Schutz für Investoren – aber zu welchem Preis?
Der Fall Vattenfall steht sinnbildlich für eine hochemotional geführte Debatte. An der einen Front stehen die Kritiker. Sie fürchten, der Profit Einzelner wiege mehr als das Gemeinwohl. Die andere Seite argumentiert, neue Gesetze dürften Investitionen nicht einfach so entwerten – wie bei Vattenfall geschehen. Hier hatte die Regierung dem Konzern nämlich vor dem Ausstieg längere Laufzeiten für die Kraftwerke versprochen.
In unserer Ringvorlesung haben die beiden Juristen Prof. Julian Scheu und Dr. Rhea Hoffmann die gegnerischen Positionen repräsentiert – wissenschaftlich statt emotional.
Scheu verteidigt die Schiedsgerichte – aus mehreren Gründen. Bevor es die Institutionen gab, haben Investitionsstreitigkeiten zwischen Investoren und einem anderen Staat laut Scheu nicht selten zu diplomatischen oder gar militärischen Konflikten geführt. Heute sollen die Abkommen vor willkürlicher Behandlung und parteiischer Justiz schützen. Ohne Schiedsgerichte würden sich viele Investoren nicht trauen, in Ländern ohne funktionierendes Rechtssystem aktiv zu werden. Sie seien deshalb auch eine Art Entwicklungshilfe für solche Länder.
Doch warum braucht es einen Investitionsschutz auch zwischen Staaten mit unabhängigen nationalen Gerichten? Vattenfall etwa ist parallel zur Klage in Washington bereits vor das Bundesverfassungsgericht gezogen – erfolgreich. In Washington könnte Vattenfall nun eine höhere Summe erstreiten, als das deutsche Gericht dem Konzern zugesprochen hat. Doch Recht bekommen haben die Schweden auch so. Scheu argumentiert wie folgt: Einige europäische Staaten wie Polen oder Ungarn würden aktuell beweisen, dass Rechtsstaatlichkeit nicht von Dauer sein muss und Investitionsschutz auch deshalb sinnvoll sei.
Hier könnt ihr die Stellungnahme Vattenfalls zu dem Verfahren lesen.
Dass Vattenfall vor dem Schiedsgericht auf mehr Geld hoffen darf, hat einen Grund: Die Richter urteilen nicht nach nationalen Gesetzen, sondern nach dem Recht, auf das sich Staaten in den Investitionsschutzabkommen geeinigt haben. Der dort festgeschriebene Investorenschutz gehe oft weiter als der in nationalen Gesetzen vorgesehene, sagt Rhea Hoffmann.
Reformen sind möglich
Hier setzt ihre Kritik an: Vor allem früher seien die Abkommen sehr vage formuliert gewesen. Die Schiedsrichter müssen die Begriffe – etwa, was überhaupt Enteignung ist – erst einmal auslegen und hätten dadurch weite Spielräume, so Hoffmann. Das sei auch ein demokratisches Problem: Zwar muss in Deutschland das Parlament solchen Investitionsschutzabkommen zustimmen. Diese würden aber oft einfach abgenickt. Und nach der Zustimmung zu einem Abkommen habe das Parlament keinen Einfluss auf die Auslegung.
Ihre Forderung: Neben Reformen im Verfahren, die sie für nötig hält, um die Schiedsgerichte transparenter zu machen oder demokratisch besser zu legitimieren, müssen vor allem die Inhalte reformiert werden. Das bedeutet: Staaten sollen präzisere Formulierungen in die Abkommen schreiben, die Auslegung stärker eingrenzen und klarer machen, wann zum Beispiel ein Umweltgesetz Schadensersatz möglich macht – und wann nicht. In ihrer derzeitigen Form gehörten die Schiedsgerichte abgeschafft. Tatsächlich seien neuere Abkommen schon heute deutlich präziser, bemerkt Scheu. Doch auch er sagt, dass in diesem Punkt nachgebessert werden müsse.
Die Politik denkt nun über Reformen nach, nicht zuletzt wegen tausender Demonstranten, die während der TTIP-Verhandlungen gegen Schiedsgerichte demonstriert haben. Zur Debatte steht ein multilateraler Schiedsgerichtshof, für den die EU-Kommission wirbt. Die Verfahren dort sollen öffentlich sein, 15 fest berufene Richter sollen entscheiden und Interessenskonflikte so vermieden werden.
In der Ringvorlesung haben Scheu und Hoffmann detailliert über das Für und Wider der Schiedsgerichte gestritten. Hier könnt ihr euch das Gespräch in ganzer Länge ansehen.
Autorin: Nora Kolhoff

„Ich blogge für die Ringvorlesung, weil mich interessiert, wie Handel nachhaltiger und gerechter gestaltet werden könnte. Ich hoffe, dass die Dozenten, anders als ich es in den Grundfächern VWL an der Uni Köln kennengelernt habe, auch außerhalb des Rahmens denken. Deshalb freue ich mich insbesondere auf Fragestellungen wie: Warum wir Freihandelsverlierer*innen entschädigen müssen oder welche Rolle die Monopolisierung durch Riesenkonzerne spielt. Und ich bin gespannt auf Kritik und Anmerkungen zu meinen Texten!“